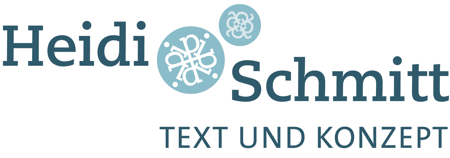Der Mensch als Marke.
Schon seit vielen Jahren ist es üblich, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich selbst als Marke betrachten. Rhetoriktrainer, Imageberater, der gezielte Einsatz von Fotos in der Presse, das alles ist längst nicht nur amerikanischen Politikern vorbehalten. Man verkauft ein Bild von sich, je klarer, einfacher und eindeutiger, desto merkfähiger und damit besser. Eine Markenstrategie.
Das Internet im Allgemeinen und die Sozialen Medien im Besonderen haben die Lage aber verändert. In zweierlei Hinsicht. Erstens hat der Begriff „in der Öffentlichkeit stehen“ an Bedeutung verloren. Denn aus dem kleinen Kreis derer, über die man etwas in den Medien lesen kann, ist eine unüberschaubare Masse geworden. Die meisten von uns kann man googeln, von vielen findet man Bilder, Erwähnungen, eigene Publikationen. Über nahezu jeden gibt es öffentlich zugängliche Informationen. Zweitens beschränkt sich die Arbeit am eigenen Image längst nicht mehr auf den Beruf. Job und Privatleben lassen sich immer schwerer trennen, Kollegen und Vorgesetzte begegnen uns auf Twitter, Facebook und anderen Netzwerken.
Es droht Unübersichtlichkeit und damit ein Kontrollverlust, der ein ganz neues Tätigkeitsfeld geschaffen hat: Experten des Online-Reputationsmanagement kümmern sich um das Löschen von Jugendsünden aus Foren und Kommentaren und arbeiten daran, Unangenehmes in Suchmaschinen nach hinten zu drängen. Das neue „Recht auf Vergessenwerden“ aus dem Mai 2014 zog mehrere 10.000 Löschungsanträge nach sich.
Gleichzeitig wird der Ruf immer lauter, man müsse sich selbst als Marke begreifen. „Human Branding“, „Selfbranding“ oder „Persönlichkeitsmarketing“ lauten die Zauberworte dafür. Der erfolgreiche Autor Jon Christoph Berndt („Die stärkste Marke sind Sie selbst!“) entblödet sich nicht, hinter seinen Namen ein ® zu setzen, um seine Markenrechte an sich selbst zu verdeutlichen. Tatsächlich hat er den Namen in drei Kategorien eintragen lassen. Marco de Micheli, dessen Verlag „Erfolgsratgeber“ herausgibt, findet es unter der Überschrift „Die Marke Ich – wie Sie zu einer Top-Marke werden“ kein bisschen seltsam, Lebenspartner, Kinder und Freunde als „Zielgruppen“ zu bezeichnen. Paul Misar, der sich selbst „Lifedesigner“ nennt, hilft nach eigenen Angaben „jährlich tausenden von Menschen, Ihre Lebensmission zu erkennen und um diese herum eine einzigartige Marke aufzubauen.“ Der Motivationstrainer und Laufexperte Andreas Butz empfiehlt, das Hobby Laufen gezielt zur Bildung der „Ich-Marke“ einzusetzen.
Bewusst oder unbewusst beginnen wir zunehmend, das eigene Bild zu polieren. Auf Facebook präsentieren wir uns mit Gruppenbildern als Menschen mit einem großen Freundeskreis, mit Selbstgebackenem als kreative und geschickte Köchin, mit Kindern als liebevolle Eltern mit einer intakten Familie, mit GPS-Daten als leistungsfähige Radfahrer und Läufer, mit Urlaubsbildern als weltgewandte und wohlhabende Zeitgenossen, mit Buchlisten als belesen, mit Konzertbildern als kulturell interessiert. Die dunklen, traurigen, misslungenen, verzweifelten, blöden, langweiligen Momente bleiben aus naheliegenden Gründen außen vor. Was macht das mit uns, wenn die „authentischen Ich-Marken“ um uns herum nur glorreich sind?
Als Freelancerin tue ich gut daran, mein Profil und meine Qualifikation klar darzustellen. Ich muss zeigen, was ich kann und was ich besser kann als andere. Ich muss mich auch gegenüber meinen Wettbewerbern abheben. Ist die Person Heidi Schmitt deshalb eine Marke?
Gute Markenprofile sind klar, einfach und nicht besonders komplex. Sie haben ein eindeutiges Erscheinungsbild, was nur vorsichtig der Zeit angepasst wird. Marken müssen sich unablässig am Wettbewerb messen. Marken sind komplett und vollständig auf Außenwirkung angelegt. Hinter einer Marke stehen Waren, ihr Sinn ist der wirtschaftliche Erfolg. Was passiert mit uns, wenn wir uns mit Waren vergleichen? Wenn wir unablässig danach trachten, uns zu verkaufen – im Job, bei der Partnerwahl, vor den Freunden?
Was passiert mit unserer Ich-Marke, wenn wir krank werden? Wenn wir Haare verlieren und im Rollstuhl sitzen? Was bleibt von uns, wenn das Erscheinungsbild nicht mehr stimmt? Wie verstecken wir all unsere Eigenschaften, Leidenschaften, Süchte, die nicht in die Norm passen? Wenn wir alle Marken werden – was sind dann die, die so sehr mit der eigenen Existenz beschäftigt sind, dass sie auf das Image keinen Wert legen können? Sind Obdachlose No Name-Produkte? Billig-Ware? Niemand käme auf die Idee, einen Baum, eine Blume oder das eigene Haustier als Marke zu bezeichnen (außer Monsanto, aber das ist ein anderes Thema). Nun mag eine Katze andere Eigenschaften haben als ein Mensch, aber ich habe mit ihr dennoch mehr gemeinsam als mit einer Zahnpastatube.
Je mehr wir versuchen, durch eine Ich-Markenstrategie unverwechselbar zu werden und dabei den Ratschlägen von „Lifedesignern“ folgen, desto weiter entfernen wir uns von der Unverwechselbarkeit, die uns bereits vor unserer Geburt eigen war, ganz ohne unser Zutun.
Wir alle sind ein wunderbares Ergebnis unserer Gene, der Erfahrungen unserer Vorfahren, unseres Umfeldes, unserer Erziehung und Bildung und dem, was wir selbst aus uns gemacht haben. Wir sind vielschichtiger, widersprüchlicher, schwieriger und großartiger, als es eine Marke je sein könnte. Wir müssen uns vereinfacht und fokussiert darstellen, wenn wir Leistungen von uns verkaufen wollen. Warum wir unsere Persönlichkeit darüber hinaus zu einer Marke schrumpfen sollten, erschließt sich mir nicht.
Bilder: © DEwerner, Z2sam – photocase.de